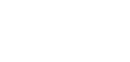Dreißig Jahre nach der Pekinger Erklärung löschen der Krieg in der Ukraine und der Autoritarismus in Osteuropa jahrzehntelange Fortschritte in der Geschlechtergleichstellung aus. Dieser Bericht zeigt auf, wie Frauen objektiviert, ausgegrenzt und zum Schweigen gebracht werden – und ruft zu dringendem feministischen Handeln auf, um den Frieden zurückzugewinnen.
Die Region Osteuropa – einschließlich Belarus, Russland, der Ukraine, der baltischen Staaten und Polen – erlebt derzeit einen alarmierenden Anstieg an Militarisierung, Autoritarismus und bewaffneter Gewalt. In den vergangenen fünf Jahren wurden konservativen Schätzungen zufolge mehr als zwei Millionen Menschen aus Belarus, der Ukraine und Russland zur Flucht gezwungen. Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur innerhalb der Landesgrenzen verheerende menschliche Kosten verursacht, sondern auch die gesamte Region tief destabilisiert, Traumata verschärft, Armut verschlimmert und jahrzehntelange Fortschritte im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit rückgängig gemacht.
Während die internationale Gemeinschaft das 30-jährige Bestehen der Pekinger Erklärung und Aktionsplattform feiert, offenbaren die Lebensrealitäten von Frauen in diesem Konfliktgebiet eine tiefe Kluft zwischen politischen Versprechen und der gelebten Realität. Ausgehend von den Grundsätzen des Beijing+30-Rahmens untersucht dieser Bericht, wie der andauernde Krieg den Fortschritt in allen zwölf zentralen Handlungsfeldern untergräbt.
Systematische Objektivierung von Frauen im Krieg
Die Dynamiken des Krieges reduzieren Frauen auf archetypische Rollen, die militaristischen und patriarchalen Agenden dienen und ihnen die Autonomie rauben:
- Patriotische Inspirationsfiguren: Frauen sollen Männer zum Kriegseinsatz ermutigen und werden als Tugendsymbole oder als Musen männlicher Opferbereitschaft dargestellt.
- Reproduktive Instrumente: Nationalistische Diskurse glorifizieren Frauen primär für ihre reproduktive Rolle und fordern sie auf, „die nächste Generation von Verteidigern“ zur Welt zu bringen.
- Emotionale Arbeitskräfte: Frauen werden unter Druck gesetzt, abwesenden oder missbräuchlichen Partnern loyal zu bleiben und unerkannte emotionale Fürsorge für traumatisierte Kämpfer zu leisten.
- Hilfspersonal der Kriegsmaschinerie: Frauen werden mobilisiert, um Tarnnetze zu knüpfen, Grabenkerzen herzustellen, Geld für Waffen zu sammeln und andere geschlechtsspezifische Aufgaben zur Unterstützung des Krieges zu übernehmen.
- Propagandistinnen: Manche Frauen werden zu öffentlichen Verfechterinnen des Militarismus gemacht, preisen Widerstand und verurteilen Friedensbemühungen als Schwäche.
Diese engen Rollenbilder ersticken abweichende Meinungen und neutralisieren Frauen als politische Akteurinnen. Sie verstoßen gegen die Verpflichtungen in den Handlungsfeldern D (Gewalt gegen Frauen) und H (Institutionelle Mechanismen zur Förderung der Frau).
Die Ausbreitung von Gewalt und geschlechtsspezifischem Ausschluss
Militarisierung normalisiert Gewalt in allen Lebensbereichen, mit unverhältnismäßigen Auswirkungen auf Frauen:
- Häusliche Gewalt: Kämpfer und politische Gefangene werden als Helden verehrt, selbst wenn sie Gewalt ausüben. PTSD wird häufig als Entschuldigung für missbräuchliches Verhalten herangezogen.
- Verletzlichkeit im Exil: Geflüchtete Frauen – insbesondere aus Belarus und Russland – sind Überwachung, Einschüchterung durch Sicherheitsdienste und einem Mangel an rechtlichem Schutz ausgesetzt.
- Schweigen der Friedensstimmen: Feministische und antimilitaristische Stimmen werden marginalisiert, zensiert oder beschuldigt, den Krieg zu untergraben.
Diese Entwicklungen zementieren geschlechtsspezifische Hierarchien und verschärfen die Missstände im Handlungsfeld G (Macht und Entscheidungsfindung).
Die Krise der Männlichkeit und ihre Auswirkungen auf Frauen
Militarisierte Männlichkeit wird gefeiert und verdrängt alternative Ausdrucksformen von Männlichkeit, was die gesellschaftliche Spaltung vertieft:
- Stigmatisierung von Verweigerern: Männer, die den Kriegsdienst verweigern oder desertieren, werden geächtet, während ihre Partnerinnen die emotionale und wirtschaftliche Belastung tragen.
- LGBTQ+-Ausgrenzung: Queere Identitäten werden in militarisierten Gesellschaften weiter marginalisiert, in denen traditionelle Geschlechterrollen aggressiv durchgesetzt werden.
- Repression gegen Feministinnen: Feministische Aktivistinnen und Pazifistinnen werden kriminalisiert, ins Exil gezwungen oder delegitimiert.
Diese Dynamiken untergraben die Fortschritte in den Handlungsfeldern E (Frauen und bewaffnete Konflikte) und L (Das Mädchenkind).
Die unsichtbare Arbeit von Friedensakteurinnen
Während staatliche Institutionen zusammenbrechen oder militarisiert werden, treten Frauen auf lokaler Ebene in die Bresche:
- Unbezahlte Ersthelferinnen: Von Frauen geleitete Initiativen leisten Traumabegleitung, Rechtsberatung, Schutzräume und Öffentlichkeitsarbeit unter enormem Druck.
- Erschöpfung und Burnout: Aufgrund mangelnder finanzieller Mittel und Schutzmaßnahmen sind diese Frauen extrem belastet und emotional gefährdet.
- Mangelnde Anerkennung: Trotz ihrer zentralen Rolle im gesellschaftlichen Zusammenhalt werden Friedensakteurinnen systematisch von internationaler Finanzierung und politischen Entscheidungsräumen ausgeschlossen.
Dies untergräbt die Fortschritte in den Handlungsfeldern A (Frauen und Armut) und I (Menschenrechte der Frau).
Beijing+30: Der dramatische Rückschritt in allen zwölf Aktionsfeldern
Der Krieg in der Ukraine und seine regionalen Folgen haben die Fortschritte in allen zwölf Bereichen der Pekinger Plattform dramatisch zurückgeworfen:
- A. Armut: Vertreibung und wirtschaftlicher Zusammenbruch haben insbesondere von Frauen geführte Haushalte verarmt. Geflüchtete Frauen, insbesondere jene, deren Partner getötet, inhaftiert oder eingezogen wurden, sind besonders betroffen. Der Verlust von Einkommen, sozialer Absicherung und Eigentumsrechten trifft vor allem staatenlose oder undokumentierte Frauen und Mädchen aus Belarus, Russland und der Ukraine.
- B. Bildung: Konflikte unterbrechen Bildungsprozesse, während militarisierte Lehrpläne Geschlechterstereotype verstärken. Der Zugang zu Bildung für Mädchen in Kriegsgebieten oder in Flüchtlingsfamilien ist stark eingeschränkt. Flüchtlingsfrauen haben kaum Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung oder zum Studium und werden oft in prekäre, informelle Arbeitsverhältnisse gedrängt.
- C. Gesundheit: Psychische Gesundheit, reproduktive Versorgung und Traumabehandlung werden im Krieg vernachlässigt. Viele Frauen und Mädchen aus Belarus, Russland und der Ukraine leiden unter unbehandelten Traumata, einschließlich PTSD, sexueller Gewalt und Missbrauch, bei gleichzeitig minimalem Zugang zu psychologischer Unterstützung.
- D. Gewalt: Geschlechtsspezifische Gewalt nimmt zu, wird normalisiert und bleibt oft unberichtet. Häusliche Gewalt steigt, insbesondere in Familien von Kriegsheimkehrern oder politischen Gefangenen. Das Risiko sexueller Gewalt und Menschenhandels ist für geflüchtete Frauen und Mädchen besonders hoch. Stigmatisierung und fehlende rechtliche Möglichkeiten verhindern, dass Betroffene Hilfe suchen.
- E. Bewaffnete Konflikte: Frauen werden aus Friedensprozessen ausgeschlossen und für Antikriegspositionen verfolgt. Feministische Antikriegsaktivistinnen werden in Russland und Belarus kriminalisiert und in der Ukraine stigmatisiert. Friedensverhandlungen berücksichtigen selten geschlechtersensible Perspektiven oder lokale Frauengruppen.
- F. Wirtschaft: Frauen werden aus dem formellen Arbeitsmarkt verdrängt und in ungeschützte, informelle Tätigkeiten gedrängt. Besonders betroffen sind Bildung, Gesundheit und öffentlicher Dienst. Geflüchtete Frauen aus Belarus, Russland und der Ukraine werden häufig unterbezahlt oder in der Care-Ökonomie ausgebeutet. Gleichstellung und weibliches Unternehmertum werden in wirtschaftlichen Wiederaufbauplänen kaum berücksichtigt.
- G. Macht und Entscheidungsfindung: Die Militarisierung zementiert patriarchale Machtstrukturen. Frauenbeteiligung in Regierung, Friedensräten oder Exilstrukturen bleibt symbolisch. Feministische Stimmen werden systematisch ignoriert oder diskreditiert.
- H. Institutionelle Mechanismen: Gleichstellungsinstitutionen werden im Krieg geschwächt oder abgeschafft. Im Exil stoßen Aktivistinnen auf bürokratische Hürden, fehlende Finanzierung und mangelnde Anerkennung. Menschenrechtsmechanismen werden zunehmend sicherheitspolitischen Interessen untergeordnet.
- I. Menschenrechte: Repression, Überwachung und Staatenlosigkeit beschneiden die Rechte von Frauen. In Belarus und Russland sind Aktivistinnen und deren Töchter Verhaftung, Folter und Vertreibung ausgesetzt. Sicherheitsdienste wie FSB, KGB oder VSD überwachen gezielt Kriegsgegnerinnen und Menschenrechtsverteidigerinnen. Rechtliche Unsicherheit verhindert den Zugang zu Gerechtigkeit.
- J. Medien: Unabhängige feministische Medien werden zensiert oder delegitimiert. Staatsmedien in Belarus und Russland verbreiten traditionelle Geschlechterrollen, Militarismus und Kriegspropaganda. Friedensaktivistinnen kämpfen darum, dass ihre Stimmen gehört werden.
- K. Umwelt: Krieg verursacht erhebliche Umweltschäden, die Frauen überproportional betreffen – besonders in ländlichen Regionen. Die Zerstörung von Infrastruktur wie Energie- und Wasserversorgung trifft Sorgearbeitende besonders hart. Ökofeministische Anliegen werden von militarisierten Entwicklungsagenden verdrängt.
- L. Das Mädchenkind: Mädchen in Kriegsgebieten sind besonders gefährdet: Frühverheiratung, sexuelle Ausbeutung, Zwangsarbeit und Schulabbrüche nehmen zu. Geflüchtete Mädchen aus Belarus, Russland und der Ukraine leiden unter unbehandelten psychischen Traumata.
Empfehlungen: Feministischer Friedensaufbau in Kriegszeiten
Um die Ziele von Beijing+30 zu verwirklichen, müssen folgende Punkte prioritär umgesetzt werden:
- UN-Resolution 1325 umsetzen: Frauen müssen gleichberechtigt in Friedens- und Sicherheitsprozesse einbezogen werden.
- Gesellschaftliche Entmilitarisierung: Beendigung der Kriegsverherrlichung in Medien, Bildung und Politik.
- Unterstützung für Kriegsverweigerer: Programme zur Reintegration und Entstigmatisierung von Deserteuren und Verweigerern.
- Schutz für geflüchtete Frauen und Mädchen aus Belarus, Russland und der Ukraine: Rechtlicher, psychosozialer und physischer Schutz muss garantiert werden. Abschiebungen von Aktivistinnen und Menschenrechtsverteidigerinnen müssen gestoppt werden.
- Feministische Netzwerke finanzieren: Lokale Frauengruppen brauchen Ressourcen, Anerkennung und strukturelle Unterstützung.
Fazit
Dreißig Jahre nach Peking zeigt der Krieg in der Ukraine, wie fragil Gleichstellung unter der Last von Militarismus und Autoritarismus ist. Feministischer Friedensaufbau ist kein Luxus – er ist Voraussetzung für nachhaltigen Frieden. Die internationale Gemeinschaft muss weibliche Führung nicht nur im Überleben, sondern im Widerstand anerkennen, fördern und absichern.
Die wahre Messlatte für unser Engagement im Rahmen von Beijing+30 ist, ob wir an der Seite von Frauen und Mädchen stehen – nicht nur in Konferenzräumen und Strategiepapieren, sondern auch in Flüchtlingsunterkünften, Aktivist*innenkreisen und den stillen Räumen postkonfliktueller Traumata. Die Zeit zum Handeln ist jetzt.
Olga Karach, International Centre for Civil Initiatives „Our House“
![]()
Es gibt viele Möglichkeiten, unserem Haus zu helfen.

 Die auf dieser Seite gespendeten Gelder sind zur Unterstützung der Arbeit unserer Website bestimmt: Wir bezahlen das Hosting, den E-Mail-Server, das Internet, die Domain, die Büromiete und kommunale Dienstleistungen.
Die auf dieser Seite gespendeten Gelder sind zur Unterstützung der Arbeit unserer Website bestimmt: Wir bezahlen das Hosting, den E-Mail-Server, das Internet, die Domain, die Büromiete und kommunale Dienstleistungen.
Wenn du kein Fan von Kaffeekonten oder Elon Musk bist – kein Problem!
Du kannst uns trotzdem ganz einfach über Stripe unterstützen.
Schnell, sicher und ohne Registrierung: 👉 https://buy.stripe.com/4gw6ppaH20UO6MUbII